Prof. Dr. Heiner Flick
eröffnete die Veranstaltung und gab eine ausführliche und sehr
anschauliche Einführung in den Rhön-Vulkanismus. Über
einem triassischen Sockel aus Buntsandstein, Muschelkalk und
stellenweise vorhandenem Keuper liegen durch Vulkanismus entstandene
Basaltdecken, die somit die Triaslandschaft stellenweise überformt
haben. Vor allem auf der zentralen Hochfläche der Hohen Rhön findet sich
eine ausgedehnte, mehr oder weniger geschlossene Basaltdecke. Die
tertiären Vulkane der Rhön sind vergleichsweise jung und wurden
hauptsächlich in zwei Förderphasen (21–18 mill. Jahre und 14–11 mill.
Jahre) gefördert. Darüber hinaus gibt es in der Rhön zwei
unterschiedliche Eruptivgesteine, die nicht durch Übergänge verbunden
sind: die Basaltfamilie (basalitische Schmelze) und die Trachytfamilie
(phonolitisch-trachylitische Schmelze). Da Basalt und Phonolith aufgrund
ihrer Genese und Zusammensetzung eng miteinander verwandt sind, sind zur
sicheren Bestimmung weiterer Mineralstoffkomponenten und damit zur noch
genaueren Klassifizierung der beiden Gesteins-Familien Untersuchungen in
doppelt polarisiertem Licht notwendig, so Flick.
Beide Eruptivgesteine sind sehr hart und setzen der Verwitterung und Abtragung großen Widerstand entgegen, so dass insbesondere in der Kuppenrhön Basaltkegel heraus modelliert wurden, die so charakteristisch für das Landschaftsbild der Rhön sind.
Anhand von Fotos, Kartenmaterial und Modellen veranschaulichte der
Referent an Beispielen aus der Hohen Rhön die erste vulkanische Phase,
aus der die meisten Basaltvorkommen stammen. Hier wurden die Wasserkuppe
und der Schafstein erwähnt. Anhand einer modellhaften Darstellung wurde
die Entstehung der Säulenbildung und deren Zerfall zu Basaltschutt
erläutert. Der Fuchsstein, in der Nähe der Wasserkuppe gelegen, weist
Relikte eines Lavastroms auf, am Abhang des Pferdskopf kann man die
Front eines Lavastroms entdecken. Der auflässige Steinbruch am
Gebirgsstein in den Schwarzen Bergen lässt Reste eines Schlackenkegels
erkennen, zeigt also Relikte der Füllung eines Vulkantrichters. Im
Bereich der Kuppenrhön gilt die Milseburg, wie wissenschaftliche
Untersuchungen gezeigt haben, mit ihren dicken, am Gipfel leicht nach
Osten geneigten Säulen als Zentrum des Rhönvulkanismus. Neben
Quellkuppen, zu denen außer der Milseburg beispielsweise auch der Große
Ziegenkopf gehört, gibt es sogenannte Staukuppen. Letztere bilden keine
Säulen, sondern eine plattenförmige Oberfläche aus. Nicht unerwähnt
blieb die Steinwand, die, so Prof. Flick, in die Liste der nationalen
Geotope aufgenommen werden soll. Diese imposante „Wand“ erstreckt sich
über eine Größe von 600 x 300 Metern und setzt sich aus unterschiedlich
stark geneigten Phonolithsäulen zusammen. Die Stellung der Säulen deutet
darauf hin, dass es sich nicht um eine senkrecht stehende Spaltenfüllung
handelt, sondern um den Rand eines flach schüsselförmigen
Intrusionskörpers, einen sogenannten Lopolith, handelt
Von der hessischen in die thüringische Rhön
führte der sich anschließende Vortrag von Frank Gümbel,
der über den ehemaligen Maarsee bei Klings berichtete –
ein Gebiet, das übrigens im 18. Jahrhundert zum Bistum Fulda gehörte.
Heute findet sich an der genannten Stelle zwischen Klings und Diedorf
ein Basalt-Steinbruch. Anhand von Schnitten konnte verdeutlicht werden,
dass der Basalt hier teilweise bis an die den Basalt umgebende
vulkanische Brekzie abgebaut wurde. Bei diesem Basaltvorkommen handelt
es sich um Magma, das vor fast 20 Millionen Jahren aus dem Erdinneren
aufgestiegen war und in der Hohlform eines Maarvulkans erstarrte. Durch
diese Eruption wurde ein Maarsee, der sich in einer Ruhephase nach einer
ersten Eruption des Vulkans gebildet hatte, zerstört. Als Maare werden
große trichter- bis wannenförmige Vertiefungen in der Erdoberfläche
bezeichnet, die einen ganz besonderen Vulkantyp darstellen.
Verschiedene Seesedimente, wie Reste von Wasserulmen und Schilf sowie von Rüsselkäfern, Wanzen, Fröschen und Eier von Wasserflöhen belegen eine längere Existenz dieses Maarsees und lassen Rückschlüsse auf die Gestaltung der ihn umgebenden Landschaft zu. Gümbel ist es ein besonderes Anliegen, dass dieser Aufschluss als herausragendes Geotop unter Schutz gestellt und nach Beendigung des Steinbruchbetriebs als Maarsee renaturiert wird.
Ferner wurde auf den südlich von Vacha am
Nordrand der thüringischen Rhön gelegenen Dietrichsberg eingegangen, der
ähnliche Verhältnisse aufweist. Als in diesem Bereich in den Jahren
1977/78 Vorerkundungen für den Basaltabbau stattfanden, wurden auch
hier, so Gümbel, feingeschichtete Seesedimente mit Resten von
Flügelfrüchten, Wildbienen, verschiedenen Käferarten, Libellen sowie
Fledermaus- und Schildkrötenreste gefunden, die eine Rekonstruktion der
Landschaft dieses Maars am Dietrichsberg ermöglichten.
Den Abschluss der diesjährigen Wissenschaftlichen Tagung bildete Kerstin Bär, von der Vulkanologischen Gesellschaft, die sich mit den Zuhörern auf eine Spurensuchen nach Vulkangebieten im benachbarten Vogelsberg begab. Zunächst verdeutlichte eine geologische Übersichtskarte, dass dieses Vulkangebiet als nördliche Verlängerung des Oberrheingrabens anzusehen ist und einen Durchmesser von rund 60 Kilometern aufweist. Basaltblöcke, Säulenbildungen und Basaltwände sind auch im Vogelsberg zu entdecken, wozu eine Reihe von Beispielen, wie die 40 Meter mächtigen Basalte bei Hanau-Steinheim und der Wilde Stein bei Büdingen angeführt wurden.
Da der Vogelsberg weithin eingebrochen und
abgetragen wurde und daher heute ziemlich flach erscheint, erinnert er
auf den ersten Blick an einen Schildvulkan. Allerdings waren die
vorkommenden Lavaströme häufig recht zähflüssig, was gegen
Schildvulkanismus spricht. Der Vogelsberg weist aber auch einen anderen
Aufbau als ein Schichtvulkan auf. Geologische Karten zeigen vielmehr,
dass mehrere Hundert bis Tausend kleine Vulkane bzw. aschespuckende
Löcher, die über mehrere Millionen Jahre aktiv waren, die
Vulkanlandschaft des Vogelsbergs kennzeichnen.
Im Anschluss an die Vorträge war es den
Teilnehmern möglich, im Vonderau Museum gemeinsam eine Foto-Ausstellung
zu bemerkenswerten Geotopen zu besuchen. Diese Ausstellung kann von
Interessierten noch bis zum Ende des Jahres besucht werden.
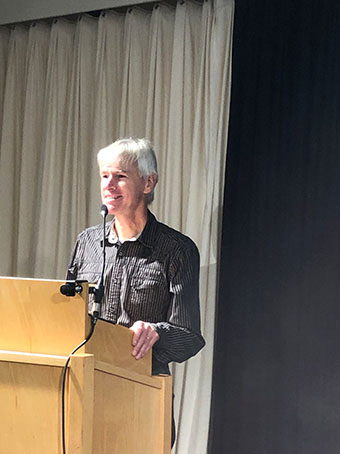
Jörg Burkard begrüßt die Anwesenden

Die Wissenschaftliche Jahrestagung fand mit ca. 60 Teilnehmern guten Anklang.

Prof. Dr. Heiner Flick erläutert den Vulkanismus der Rhön.

Frank Gümbel spricht über den Maarsee bei Klings.

Der Steinbruch zwischen Diedorf und Klings heute;
Foto: L. Schmidt


Kerstin Bär referiert über den Vulkanismus im Vogelsberg